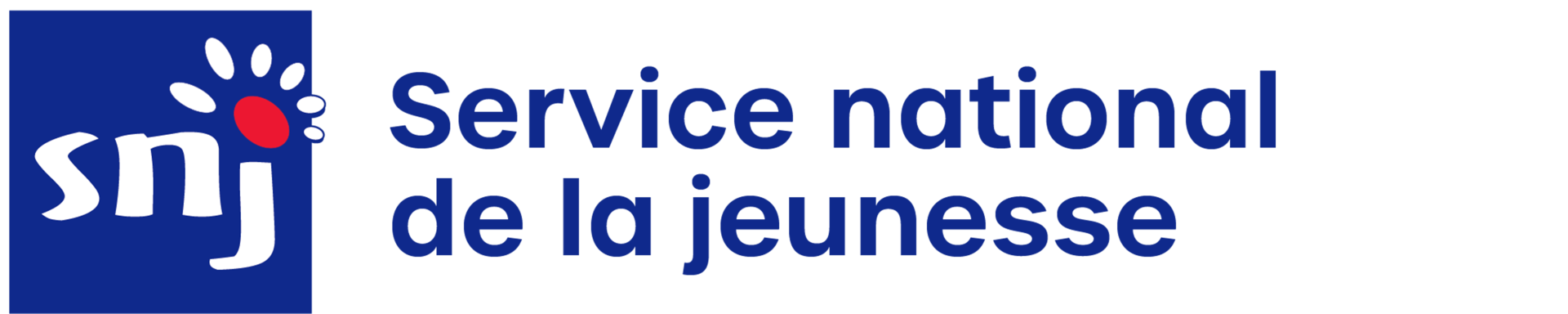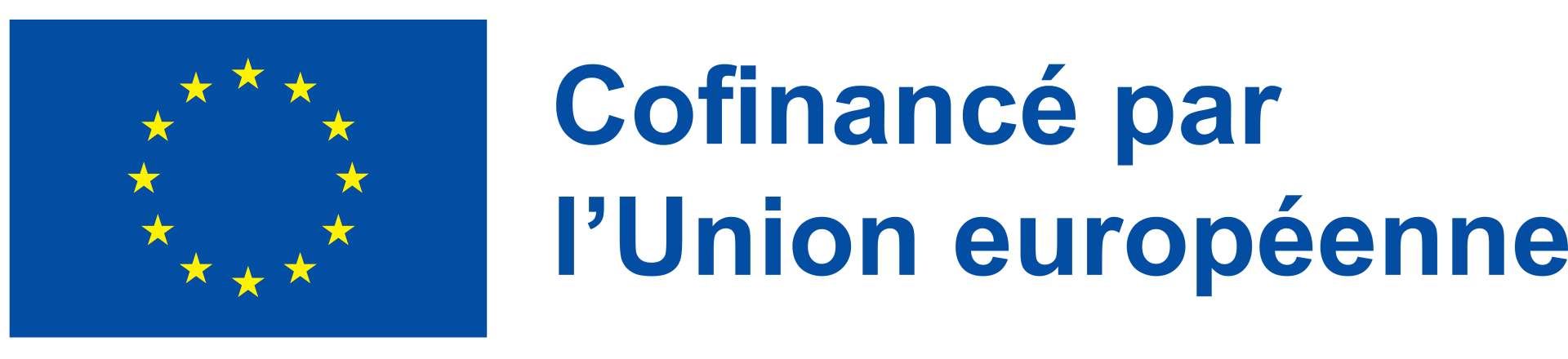Der Alltag vieler Jugendlicher spielt sich heute zu einem großen Teil online ab. Das Internet ist längst nicht mehr bloß Informationsquelle oder Zeitvertreib – es ist ein Lebensraum mit eigenen Regeln, Codes und Treffpunkten. Genau wie im analogen Leben wird auch dieser Raum von verschiedenen Generationen unterschiedlich wahrgenommen. Die Netflix-Serie Adolescence bringt diese Realität eindrücklich auf den Punkt und wirft dabei wichtige Fragen auf – insbesondere für Eltern, Erziehende und Lehrkräfte.
Ein Ort, viele Bedeutungen: Die Welt durch unterschiedliche Augen
Ein gutes Beispiel aus dem „analogen“ Alltag: Der Vorplatz der Kathedrale in Luxemburg-Stadt. Für viele Erwachsene ein Ort mit historischem Flair – für Jugendliche ein Skate-Spot. Eine Parkbank kann für die einen zur Spielplatzkulisse gehören, für andere zum Treffpunkt nach der Schule werden. Genauso verhält es sich im Internet. Während Erwachsene Plattformen wie TikTok oder Instagram oft als Unterhaltungsmedien betrachten, suchen junge Menschen dort auch Zugehörigkeit, Ausdruck, Community – manchmal sogar Halt oder Sinn.
Diese unterschiedlichen Perspektiven führen leicht zu Missverständnissen – besonders, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Und damit sind nicht nur Worte gemeint, sondern auch Emojis.
Emojis – mehr als nur bunte Bildchen?
Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, kann im digitalen Alltag eine tiefere Bedeutung haben. Emojis sind ein fester Bestandteil jugendlicher Online-Kommunikation. Sie ersetzen nonverbale Signale, helfen beim Ausdrücken von Emotionen – und werden je nach Community auf ganz eigene und unterschiedliche Weise genutzt. In manchen Fällen entwickeln sich sogar feste Bedeutungen oder Codes, die für Außenstehende nicht sofort verständlich sind.
In einer Szene der Serie Adolescence wird deutlich, wie Emojis in bestimmten Online-Subkulturen gezielt als Codes eingesetzt werden. In diesem Fall stammen die Zeichen aus der sogenannten „Manosphäre“ – einem digitalen Umfeld, in dem unter anderem frauenfeindliche Ideologien verbreitet werden. Die Emojis beziehen sich auf die „Incel“-Community, also Männer, die sich selbst als unfreiwillig alleinstehend sehen und daraus Frustration oder Ablehnung gegenüber Frauen entwickeln.
Beispiele aus der Serie:
- 🧨 Dynamit: Steht für einen Incel – einen Mann, der sich gesellschaftlich benachteiligt fühlt.
- 💯 100-Emoji: Symbolisiert die „80/20-Regel“, nach der nur ein kleiner Teil der Männer als attraktiv gilt – ein häufiges Argument in Incel-Foren.
- 💊 Rote Pille: Verweist auf die vermeintliche „Erkenntnis“, dass Frauen manipulativ seien und Männer systematisch benachteiligt würden.
Doch wichtig ist: Emojis sind nicht per se gefährlich. In den allermeisten Fällen dienen sie einfach der Betonung oder dem Spaßfaktor. Eltern und Lehrkräfte sollten sich nicht von jedem Emoji verunsichern lassen – aber sensibilisiert sein, wenn mehrere Signale auf problematische Inhalte oder Gruppenzugehörigkeiten hinweisen.
Ein Überblick über gängige Emoji-Codes und deren mögliche Bedeutungen (auch in problematischen Kontexten) findet sich z. B. im Artikel des STANDARD.
Was Eltern und Lehrkräfte tun können
Auch wenn es unmöglich ist, jede Online-Subkultur zu kennen oder jede Bedeutung eines Emojis zu entschlüsseln – es gibt Wege, wie Erwachsene Jugendlichen zur Seite stehen können ohne die Emoji-Welt bis ins kleinste Detail zu kennen:
- Offen bleiben
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über dessen Online-Erfahrungen – ohne gleich zu bewerten oder zu urteilen. Interesse zeigen statt Kontrolle ausüben hilft, Vertrauen aufzubauen. - Gemeinsam hinschauen
Werfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen Blick auf genutzte Apps oder Inhalte. Fragen Sie nach, was bestimmte Symbole oder Trends bedeuten – Jugendliche sind oft bereit, zu erklären. - Warnsignale erkennen
Achten Sie auf Verhaltensänderungen, Rückzug, Leistungsabfall in der Schule oder auffällige Aussagen. Diese können Hinweise auf Belastungen oder den Einfluss problematischer Inhalte sein. - Medienkompetenz fördern
Ermutigen Sie Jugendliche, kritisch mit Online-Inhalten umzugehen. Sprechen Sie über Desinformation und Algorithmen– und wie man sie erkennen kann. - Hilfsangebote nutzen
Wenn Sie unsicher sind oder das Gefühl haben, dass Ihr Kind in Schwierigkeiten steckt, können Sie sich an die BEE SECURE Helpline wenden. Die kostenlose und anonyme Beratungsstelle ist erreichbar unter 8002 1234 oder über bee-secure.lu.
Eine Einladung zum Gespräch – nicht zur Panik
Die Serie Adolescence zeigt, wie komplex die digitale Welt für junge Menschen sein kann – aber auch, wie wichtig Verständnis statt Verunsicherung ist.
Nicht jedes Emoji ist ein Warnsignal, nicht jeder Trend problematisch. Entscheidend ist, wie wir reagieren: mit Offenheit, Vertrauen und Bereitschaft zum Gespräch.
Solche Serien und Themen können ein Anlass sein, um ehrlich über Unterschiede in der Wahrnehmung zu sprechen – über digitale Ausdrucksformen, Zugehörigkeit, aber auch über Ablehnung, Hass und Rollenbilder.
Je mehr wir voneinander verstehen, desto besser können wir diese Lebenswelt gemeinsam sicher gestalten.
Weitere Infos und Angebote
- Thematischer Beitrag zum Thema „Hate Speech“ : Jetzt lesen
- Expertentrio für Eltern: Jetzt anmelden zum Elternabend am 25.04.2025