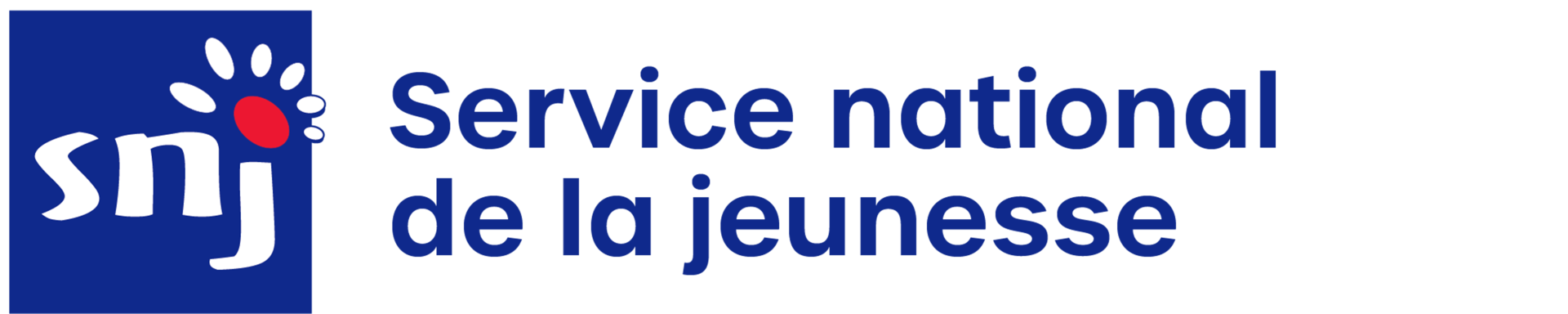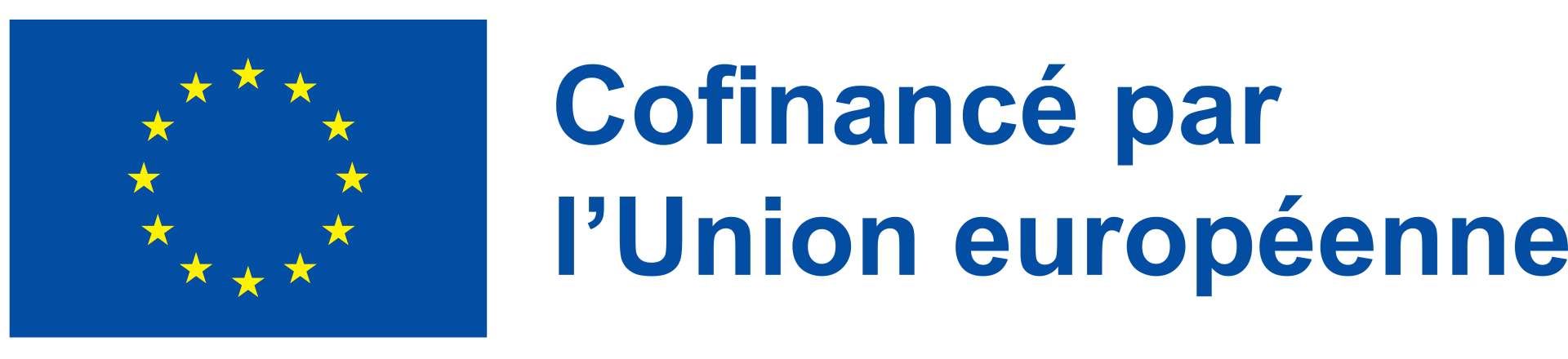Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube setzen zunehmend auf automatisierte Systeme, um Inhalte zu überprüfen. Was auf den ersten Blick sinnvoll erscheint – nämlich problematische Inhalte frühzeitig zu erkennen – kann im Alltag zu Herausforderungen führen: Beiträge werden unsichtbar, obwohl sie eigentlich harmlos oder sogar aufklärend gemeint sind. Um das zu umgehen, greifen viele Nutzer, darunter auch immer mehr Jugendliche, auf kreative Mittel zurück. Eine dieser Strategien heißt Algospeak – eine Art Codesprache im Netz. Was steckt dahinter? Welche Begriffe und Emojis werden verwendet? Und wie lässt sich Algospeak im Alltag erkennen und einordnen?
Was ist Algospeak – und warum wird es verwendet?
Algospeak beschreibt eine bewusst veränderte Form der Sprache in sozialen Netzwerken. Wörter werden abgewandelt, Buchstaben durch Zahlen oder Sonderzeichen ersetzt (z. B. „Seggs“ statt „Sex“) und Emojis bekommen neue Bedeutungen. All das passiert mit einem Ziel: Die Inhalte sollen trotz automatischer Filter sichtbar bleiben.
Der Ursprung liegt in der Art und Weise, wie Plattformen Inhalte moderieren. Bestimmte Schlagwörter lösen automatisch Warnhinweise aus oder führen dazu, dass Beiträge in ihrer Reichweite eingeschränkt werden. Das kann problematische Inhalte betreffen – aber auch Beiträge zu sensiblen Themen wie psychischer Gesundheit, Diskriminierung oder Aufklärung.
Manche greifen daher auf codierte Begriffe zurück – aus Schutz, zur Umgehung der Filter oder auch aus kreativem Ausdruck heraus. Der sogenannte #MascaraTrend auf TikTok ist ein Beispiel: Unter dem Deckmantel eines Schminktipps berichteten Betroffene über Erfahrungen mit Missbrauch – verschlüsselt, aber verständlich für Eingeweihte.
Wenn ein Emoji mehr sagt als tausend Worte
Ein zentrales Element von Algospeak ist die gezielte Verwendung von Emojis. Was eigentlich zur spielerischen Kommunikation gedacht ist, wird in bestimmten Kontexten zur symbolischen Sprache – oft doppeldeutig, manchmal grenzüberschreitend.
Beispiele für sexualisierte oder zweideutige Emoji-Verwendungen:
- 🔥 : „Du bist heiß“ – Ausdruck körperlicher Attraktivität
- 💦 : Andeutung von Ejakulation
- 🍆 : Symbol für das männliche Geschlechtsorgan
- 🍒 : Seht für weibliche Brüste
- 👅 : Anspielung auf orale Sexualität
- 🥒 : Alternative Darstellung mit sexueller Konnotation
Solche Emojis tauchen häufig in Kommentaren, Storys oder Direktnachrichten auf – einzeln oder in Kombination. Je nach Absicht können sie verspielt, ironisch oder übergriffig wirken. Besonders im Zusammenspiel mit bestimmten Aussagen oder Aufforderungen wird deutlich, dass es sich um mehr als nur einen harmlosen Smiley handelt.
Wenn Emojis Teil ideologischer Codes werden
Doch nicht nur im Bereich Sexualität wird symbolisch kommuniziert. Auch in bestimmten Online-Subkulturen – etwa in der sogenannten Incel- oder Red-Pill-Szene – oder in der Neo-Nazi Szene haben sich Emojis zu identitätsstiftenden Symbolen entwickelt.
Einige Beispiele:
- 💯 (Hundert Prozent): Wird genutzt, um der sogenannten 80/20-Regel Ausdruck zu verleihen – der Annahme, dass 80 % der Frauen nur an 20 % der Männer interessiert seien. Diese Vorstellung dient in Teilen der Red-Pill-Community als Begründung für Frauenfeindlichkeit.
- 💊 (rote Pille): Bezieht sich auf das „Red Pill“-Narrativ aus dem Film Matrix, wird aber in Online-Foren als Symbol für den angeblichen „Realitätsblick“ einer männerdominierten Gesellschaft verwendet. Dahinter steht oft ein klar antifeministisches Weltbild.
- ⚡ ⚡ (zwei Blitze): Bezieht sich auf die doppelte Sigrune, das Zeichen der Schutzstaffel („SS“).
Wichtig: Diese Emojis sind nicht per se problematisch. Entscheidend ist, wie und in welchem Zusammenhang sie eingesetzt werden. In Diskussionen oder Posts mit klarer ideologischer Färbung dienen sie jedoch oft als Erkennungszeichen oder implizite Botschaft.
Was Plattformen tun – und was unklar bleibt.
Viele Plattformen haben inzwischen reagiert. Verbreitete Algospeak-Begriffe werden zunehmend erkannt. Wer z. B. auf TikTok nach dem codierten Begriff „Sewer Slide“ (für „Suicide“) sucht, bekommt denselben Warnhinweis und Hilfsangebote wie bei der Suche nach dem Originalwort.
Dank künstlicher Intelligenz können Inhalte inzwischen auch kontextbasiert überprüft werden. So lässt sich etwa unterscheiden, ob der Begriff „Auschwitz“ in einem erinnerungskulturellen Zusammenhang steht – oder in einem problematischen.
Trotzdem bleibt vieles intransparent. Nutzer erhalten selten eine Rückmeldung, warum ein Beitrag weniger Reichweite bekommt oder gar nicht angezeigt wird. Auch die Kriterien, nach denen Inhalte bewertet werden, sind oft nicht öffentlich zugänglich.
Digitale Codes verstehen und einordnen
Algospeak ist ein Spiegel der digitalen Kommunikationskultur: kreativ, wandelbar, manchmal herausfordernd. Was als Schutzmechanismus beginnt, kann zur Verschlüsselung problematischer Inhalte führen. Emojis sind längst mehr als Dekoration – sie sind Teil der Sprache geworden.
Wer Inhalte erstellt, moderiert oder vermittelt, sollte daher nicht nur die Worte lesen, sondern auch die Zeichen dazwischen. Denn digitale Sprache ist immer auch eine Frage des Kontexts.
Dieser Ratgeber (Sprache: englisch) hilft dabei, gängige Emojis von Jugendlichen besser einzuordnen: https://resources.saferschoolstogether.com/view/294238754/
Dieser Text basiert auf einem Artikel unseres Partners klicksafe.de: